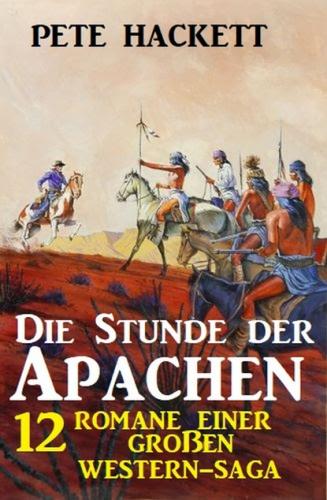Die Stunde der Apachen: 12 Romane einer großen Western-Saga. Pete Hackett
Читать онлайн книгу.Whitlock vernahm das sich schnell entfernende Hufgetrappel. Er presste die Lippen zusammen, sodass sie nur noch einen dünnen, blutleeren Strich bildeten. Das Pferd wurde nach Süden gejagt, in Richtung Grenze also. Whitlock richtete sich auf und rannte zurück. Plötzlich hatte er den verwundeten Apachen vor sich. Der Krieger klebte regelrecht mit dem Rücken an einem Felsen, die linke Hand auf die Schulterwunde pressend. Das Gewehr hielt er in der Rechten.
Sofort verhielt Whitlock, krümmte sich nach vorn und riss den Karabiner an die Hüfte.
»Nicht schießen!«, schrie der Krieger mit kippender Stimme und ließ das Gewehr fallen. Er hatte es im Mimbres-Dialekt hervorgestoßen, aber Whitlock verstand ihn dennoch. Der Apache rutschte langsam am Felsen zu Boden und stöhnte gequält.
Whitlock näherte sich dem Krieger mit der gebührenden Vorsicht. Die Heimtücke im Blick des Apachen war nicht zu übersehen. Er konnte Whitlock nicht täuschen, auch wenn er sich gab wie ein vom Schmerz ausgehöhlter und vom Blutverlust geschwächter Haufen Elend.
»Du gehörst zu Victorio, nicht wahr?«, presste Whitlock hervor und stieß den Krieger mit dem Gewehrlauf an. Er drückte ihm die Mündung gegen die Brust. Blut quoll zwischen den Fingern des Apachen hervor. Unter seinem linken Auge zuckte ein Muskel.
»Wir werden euch alle töten!«, zischte der Apache in schlechtem Englisch.
»Man hat Victorio Unrecht getan«, sagte Whitlock geduldig. »Ich will mit dem Häuptling sprechen. Mein Name ist Whitlock. Warst du dabei, als ich euch von Fort Wingate nach Tularosa brachte?«
»Nein. Du bist weiß und mein Feind.«
»Bring mich ins Lager Victorios, mein Freund. Wie ist dein Name?«
»Low Dog. Geredet ist genug geworden. Ihr Weißen habt mit gespaltener Zunge gesprochen. Jetzt herrscht Krieg.«
In den Augen des Kriegers blitzte es auf. Wie eine Warnung vor drohendem Unheil registrierte Whitlock es, und er vernahm hinter sich ein Geräusch. Er benötigte nicht den Sekundenbruchteil zwischen Erkennen und Reagieren. Und das rettete ihm das Leben. Ansatzlos wirbelte er herum und warf sich zur Seite. Ein Gewehrkolben pfiff an seinem Kopf vorbei, streifte ihn schmerzhaft an der Schulter, und er schaute in das verzerrte Gesicht des Apachen, der den Schlag geführt hatte. Der Schlag hätte ihm den Schädel zertrümmern sollen.
Whitlocks Bein schnellte hoch und sein Fuß knallte in den Leib des Kriegers. Er brüllte auf, brach auf die Knie nieder, riss instinktiv die Arme mit dem Gewehr hoch, aber da traf ihn Whitlock schon mit dem Gewehrkolben von der Seite gegen den Kopf. Er brach zusammen.
Der Krieger mit der Schulterwunde warf sich auf den Lieutenant, umklammerte ihn von hinten mit beiden Armen und stöhnte vor Schmerzen. Whitlock rammte den Ellenbogen zurück, traf den Krieger in den Leib und dieser löste seine Umklammerung. Der Lieutenant schleuderte sich herum. Da griff der Bursche, der am Boden lag, mit beiden Händen zu und erwischte ihn am rechten Knöchel. Whitlock versuchte sein Bein aus der Umklammerung zu zerren, rammte den Gewehrkolben auf den Krieger hinunter und traf ihn zwischen den Schulterblättern. Die Hände des Apachen öffneten sich, Whitlocks Bein war frei. Der Lieutenant schlug mit dem Gewehrlauf nach dem Apachen mit der Schulterwunde. Der Krieger brach zusammen.
Der Lieutenant hob die Waffen seiner Gegner auf und schleuderte sie weit fort. Dann verband er die Wunden der beiden Apachen und flößte er ihnen etwas Wasser zwischen die Lippen. Sie waren wach. Unter halb gesenkten Lidern hervor beobachteten sie ihn. In ihren dunklen Augen glomm das Feuer einer nicht zu unterdrückenden Leidenschaft, da waren aber auch Unsicherheit und Unverständnis.
»Warum tötest du uns nicht?«, fragte einer der Krieger kehlig. Es war der mit der Schulterverletzung. Der andere hatte nur eine stark blutende Platzwunde am Kinn, die er sich zuzog, als ihn Whitlock mit dem Gewehr aus dem Sattel schlug. Der dritte der Krieger war tot.
»Was hätte ich davon?«, fragte Whitlock.
»Zwei tote Feinde mehr...«
»Ihr seid nicht meine Feinde. Außerdem gibt es für mich keinen Grund, mich mit der Anzahl der von mir getöteten Feinde zu brüsten. Ich habe mich gegen euch lediglich zur Wehr gesetzt.« Er unterbrach sich und beugte sich über den Krieger. »Du wirst es nicht glauben, aber ich bin ein Freund des roten Mannes. Vor allen Dingen ein Freund Victorios, den ich sprechen muss. Er sollte mich anhören. Es wäre für ihn und das Volk der Mimbres von Nutzen.«
Der Krieger spuckte aus. »Worte sind Schall und Rauch, Nantan. Man hat dem roten Volk lange genug Sand in die Augen gestreut. Friede wird erst sein, wenn der letzte Weiße tot ist.«
Whitlock zog die Unterlippe zwischen die Zähne und kaute darauf herum. »Fürchtest du, dass ich in Victorios Lager reiten und ihn töten könnte?«
»Es wäre auch dein Tod.«
»Na siehst du. Sehe ich aus wie ein Selbstmörder?«
»Victorio wird dich töten lassen.«
»Darauf lasse ich es ankommen.«
»Mir scheint, du bist sehr mutig.«
»Ich will Frieden.«
»Enju, Nantan, ich glaube dir. Wir bringen dich zu Victorio. Sei dir klar, dass du offenen Auges in dein Verderben rennst.«
»Warten wir es ab. Victorio ist ein vernünftiger Mann. Er wird sich meinen Worten zugänglich erweisen.«
Whitlock verspürte eine Art von Triumph in sich. Er war Victorio so nahe wie nie zuvor seit seinem Aufbruch in Tularosa. Angst spürte er nicht. Tief in seinem Innersten war er davon überzeugt, dass Victorio kein blindwütiger Mörder war, dass dem Häuptling der herrschende Zustand ebenso wenig gefiel wie den vielen Menschen im Land, die sich nach Ruhe und Frieden sehnten.
*
Die mexikanischen Soldaten hatten sich zu beiden Seiten der Schlucht verborgen. Die beiden Ausgänge waren abgesperrt. Der Morgen graute.
Die Squaws im Lager der Apachen entzündeten Feuer. Sie holten Wasser von dem kleinen Creek, der sich durch die Schlucht sein Bett gegraben hatte. In Seilcorrals befanden sich die Reittiere der Krieger. Einige Schafe und Ziegen liefen frei in der Schlucht herum. Ein Hund bellte. Ein anderer stimmte ein.
Die Soldaten hatten in der Nacht Stellung bezogen. Die Apachen waren arglos. Erst am Vorabend war eine Gruppe Krieger zurückgekommen. Sie hatten eine Hazienda überfallen, die Bewohner getötet und einige Dutzend Rinder abgetrieben.
Ihrer Spur war die Patrouille gefolgt. Die Scouts hatten das Lager der Apachen gefunden. Es befand sich in der Sierra Amargosa. Im Schutz der Nacht hatten sie das Lager umzingelt.
Vögel begannen zu zwitschern. Die Krieger krochen aus ihren provisorischen Unterkünften und Tipis, von denen es allerdings nur wenige gab. Sie dehnten und reckten sich – und sie waren arglos.
Es wurde hell. Die Sonne stand im Osten. Kinder spielten. Hunde tollten durch das Lager. Die Kochfeuer brannten. Frauen versahen die tägliche Arbeit. Einige alte Männer hockten vor den behelfsmäßigen Unterkünften am Boden und rauchten Pfeife.
Und dann fiel ein Schuss.
Es war der Auftakt zu einer blutigen Tragödie. Die Soldaten rings um das Lager eröffneten das Feuer. Die beiden Gruppen, die die Zugänge zur Schlucht besetzt hielten, rückten vor. Squaws packten ihre Kinder und ergriffen die Flucht. Alte humpelten hinter ihnen her. Schreie der Angst, des Entsetzens und der Verzweiflung wurden laut. Kinder fingen zu weinen an. Die Krieger holten ihre Waffen, soweit sie nicht schon unter den ersten Salven zusammengebrochen waren.
Soldaten sprengten brüllend, schießend und säbelschwingend zur Mitte des Lagers und trieben die vom Grauen geschüttelten Menschen zusammen. Die ersten Zweighütten und Tipis gingen in Flammen auf. Die Soldaten trieben ihre Pferde hin und her, verfolgten Flüchtende und hieben und schossen sie nieder. Sie befanden sich in einem wahren