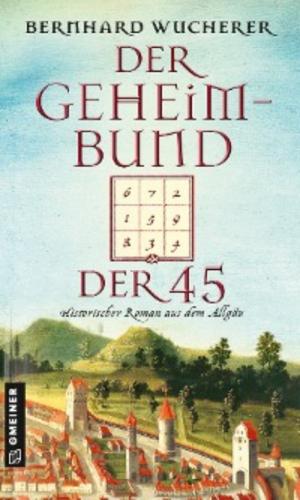Der Geheimbund der 45. Bernhard Wucherer
Читать онлайн книгу.So war der Rohbau schon bald soweit fertig, dass sie das Dach decken und den Glockenturm errichten konnten.
»Kruzifix! Wo bleibt diese verdammte Glocke, die uns der Graf versprochen hat?«, schimpfte Eberz und handelte sich dadurch eine Rüge des neuen Pfarrers ein, der vor ein paar Tagen wie aus dem Nichts in der Abenddämmerung in villa Ysinensi aufgetaucht war und sich einmal mehr hinter ihn geschlichen hatte, um zu lauschen.
Der Geistliche hatte die gotteslästernde Flucherei mitgehört. »Fünfzehn Vaterunser!«, trug er dem Sargtischler als Sühne auf.
Anstatt darauf einzugehen, blaffte der längst selbstbewusst gewordene Vorarbeiter den Priester in der einfachen Sprache des Volkes an: »Was willst du hier, Pfaffe? Schleich dich und lass uns unsere Arbeit machen!«
»Wahrscheinlich möchte er einen von uns bei der Obrigkeit hinhängen!«, bekam Eberz Schützenhilfe von einem seiner Männer, die allesamt zu lachen begannen.
Der Priester konterte, dass es ihn freuen würde, Eberz und seine Leute bei solch guter Laune vorgefunden zu haben. »Zu eurer und zur Freude Gottes darf ich euch im Auftrag unseres Grundherrn etwas mitteilen!«
Nun war es still und auch die Letzten legten ihre Arbeitsgeräte ab, um nähertreten zu können. Schließlich mochten alle mitbekommen, was ihr noch nicht offiziell eingeführter Pfarrherr zu sagen hatte.
Weil der Pfaffe die Situation und seine vermeintliche Überlegenheit genoss, fuhr er nicht gleich fort.
Gerold Eberz nahm sich wieder das Wort: »Nun sag schon, was gibt es für Neuigkeiten?«
»Du betest deine Vaterunser?« Während er auf Eberz’ Antwort wartete, blitzten die Augen des Pfarrers gefährlich auf. Dann spuckte er eine unverhohlene Drohung aus: »Du weißt, was auf Gotteslästerung steht!«
»Schon gut, nach Feierabend werde ich Zwiesprache mit unserem Herrn halten und das Dreifache der von dir geforderten Gebete sprechen!«, wehrte Eberz mit erhobenen Händen ab. »Aber nun sag schon, was …«
Um coram publico zu demonstrieren, dass sich der studierte Pfarrherr das Wort nicht von einem unbelesenen Sargtischler erteilen lassen musste, unterbrach er dessen Frage und kam endlich zur Sache: »Euer Herr lässt ausrichten, dass … die Glocke noch vor St. Martini hier sein wird!«
Weil er diese frohe Botschaft verkündet hatte, war die kleine Stichelei schlagartig vergessen und es brandete ein solcher Jubel auf, wie es ihn zum letzten Mal in villa Ysinensi gegeben hatte, als die Bevölkerung erfahren hatte, dass ihnen der Graf ein Gotteshaus spendieren würde. Damals hatten die Fronarbeiter ja noch nicht gewusst, dass sie ihre Kirche selbst errichten mussten. Aber das war in diesem Moment des Glücks egal, sie freuten sich derart auf die Glocke, dass es ihnen Antrieb gab, das Gebäude rechtzeitig bis St. Nikolaus fertigzustellen.
Die Zeit drängte, denn über den Kirchenbau hinaus hatte der Graf in Auftrag geben lassen, so viele grob gearbeitete Bänke und Tische herzustellen, dass insgesamt etwa einhundertfünfzig Gäste Platz auf dem Gelände finden konnten, auf dem die Kirchweihe auch weltlich gefeiert werden sollte. »Die könnt ihr dann behalten und von mir aus verfeuern!«, hatte er gleichsam gönnerhaft wie spaßhalber zu Eberz gesagt.
Dabei hatte der Graf offensichtlich gewusst, dass der umsichtig denkende Eberz dafür sorgen würde, die bis dahin bearbeiteten Holzbretter niemals dem Feuer zu übergeben, sondern zum Bau der längst überfälligen Kornscheuer zu verwenden. Schon seit geraumer Zeit besprach der Graf solche Dinge mehr und mehr direkt mit dem Sargtischler, anstatt mit dem Mair, der eigentlich dafür zuständig gewesen wäre. Der Grund mochte wohl darin zu suchen sein, dass Eberz ein ernsthaftes Interesse am Vorwärtskommen seines Dorfes zeigte und die Dinge anpackte, während der Mair bei den meisten anfallenden Arbeiten durch Abwesenheit glänzte und sich mehr für Alkohol als für die Allgemeinheit zu interessieren schien.
Kapitel 2
Es war ein extrem frostiger und deswegen auch ungemütlicher Dezembertag des Jahres 1042. Aber dies hatte den Konstanzer Bischof Eberhard I. nicht davon abgehalten, die schwere Mühsal trotz des schlechten Wetters auf sich zu nehmen, mit großem Gefolge ins noch kältere Allgäu zu reisen, um dort eine wichtige Mission zu erfüllen. Aber kaum in villa Ysinensi angekommen, sollte sein Vorhaben so holprig beginnen, dass er dies sogar als unheilbringendes Omen betrachtete. Denn schon am oberen Tor, durch das er ins Dorf gelangen wollte, musste er aus seiner Kutsche heraus auf ein Pferd steigen – der hölzerne Durchlass war für das breite Gefährt zu schmal gewesen. Wegen seiner durch den Matsch nass gewordenen Beinlinge fluchte der hochrangige Mann Gottes still vor sich hin, anstatt den herzlichen Empfang der hiesigen Bevölkerung zu genießen und ihr würdig zuzuwinken.
»Gott, was sind das nur für einfache Bauern«, grummelte er seinem klugen Adlatus in despektierlichem Tonfall zu.
Der Konstanzer Diakon, der bei Reisen immer an der Seite des Bischofs war, nutzte die Gelegenheit, um seinen Herrn dahingehend aufzuklären, dass er den hiesigen Menschenschlag nicht unterschätzen dürfe. In dieser hügeligen Gegend wuchsen nicht nur Dinkel und Hafer, sondern zudem wurde äußerst erfolgreich Flachs angebaut und verarbeitet, weswegen gerade die Bauern gute Abgabenzahler seien. »Was glaubt Ihr, weswegen deren Grundherr eine Kirche gestiftet hat, obwohl er ein Potentat alter Schule ist?«
»Er wird schon gewusst haben, weshalb er dies getan hat. Wahrscheinlich sind die Abgaben entgegen Eurer Meinung doch nicht so hoch, dass sie ihn zufriedenstellen.«
»Oder die Leute hier begehren gerne auf. Die Allgäuer sind ja bekannt dafür, ein streitbares Völkchen zu sein«, mutmaßte der junge Geistliche, der die braune Kutte der Benediktiner trug.
»Schon gut, mein Freund! Lasst uns lieber dafür sorgen, dass wir uns schnellstens aufwärmen und unseren Hunger stillen können, bevor wir uns zu unseren Schlafstätten begeben. Für die morgige Zeremonie müssen wir ausgeruht sein! Die Reise war lang und anstrengend, außerdem ist es teuflisch kalt!«
»Aber, aber, Euer Exzellenz!«, rügte der treu ergebene Kirchenlehrer, der gleichzeitig auch Domschatzmeister war, den Bischof für das Unwort, das der soeben in den Mund genommen hatte.
*
Die geplante Kirchen- und Glockenweihe hätte eigentlich am Tag des heiligen Nikolaus stattfinden sollen. Aber wegen eines gewaltigen Schneesturms, der über das Mare Brigantium hinweggefegt war, hatte die Delegation des Bischofs von Konstanz ihre Abreise um vier Tage verschieben müssen – für die Bevölkerung von villa Ysinensi eine gefühlte Unendlichkeit. Letztlich waren sie aber froh gewesen, noch etwas Zeit gewonnen zu haben, um ihre Siedlung herausputzen und alles für die Gäste des Grafen vorbereiten zu können. Und dazu hatte gehört, dass über den größten baumlosen Platz der Siedlung Planen gespannt wurden, unter denen die etwa einhundert erwarteten Gäste verköstigt werden konnten. Und für diejenigen, die erst am Tag nach der kirchlichen und weltlichen Feier ihren Rückweg antreten würden, sollte ein Zeltdach zur Verfügung stehen, unter dem sie ihre Häupter niederlegen konnten.
Rundherum hatten reisende Händler aus nah und fern, die im Laufe des Jahres von dieser Kirchenweihe erfahren hatten, ihre rollenden Verkaufsbuden aufgestellt. Weil sich der feierliche Anlass auch unter anderen mehr oder weniger ehrlichen Berufsgruppen herumgesprochen hatte, war neben Gauklern, Komödianten und Musikanten auch ein Heer von Falschspielern und Taschendieben angelockt worden. Sogar ein paar wandernde Gunstgewerblerinnen erhofften sich mit Gottes Hilfe gute Geschäfte, weswegen auch sie dem Tross des Bischofs von Konstanz aus hinterhergereist waren – selbstverständlich in gebührendem Abstand. Um ihrem Gewerbe ungestört nachgehen zu können, hatten sie ihren weich gepolsterten und reichlich mit Schaffellen ausgestatteten Planwagen etwas abseits der anderen Fahrzeuge abgestellt.
So etwas hatten die Einheimischen noch nie miterleben dürfen. Kein Wunder also, dass sie irritiert und völlig aus dem Häuschen waren – insbesondere, weil sich der Himmel gnädig zu zeigen schien und zum ersten Mal seit mehreren Wochen wärmende Sonnenstrahlen durch die sich zunehmend teilende Wolkendecke schickte.
*
Anderntags war es endlich so weit und der